Wir schreiben das Jahr 1971 und ich lebe in Isfahan, Iran, dem sagenumwobenen Mittelpunkt der Seidenstraße, die sich von Peking (heute Beijing) bis Konstantinopel (heute Istanbul) erstreckt. Die Leute vom Peace Corps, die dem von den USA geschützten iranischen Militär die Reparatur amerikanischer Jeeps aus Kriegsbeständen beibringen sollten, betrieben den äußerst lukrativen Haschischhandel von Afghanistan nach Europa. Die Leute von der britischen Botschaft interessierten sich für Gurdjieff und Opium. Die Intelligenzija kaufte heimlich ihr staatlich zugelassenes Opium von der Unterschicht, die sich als Opiumsüchtige registriert hatte und monatlich elegante Schachteln im Stil von Godiva Chocolate mit hübsch verpacktem und gestempeltem hochwertigem Opium erhielt. Die regierungskritischen „Studenten“ (erinnern Sie sich an Jimmy Carter und die Retter der kanadischen Filmcrew) versteckten sich stets nur hinter falschen Vornamen und verschwanden regelmäßig über Nacht durch die Hand des Geheimpolizisten Savak. Was soll ich sagen? Es waren die Zeiten.
Als traditioneller kanadischer Bauernjunge mit römisch-katholischer Erziehung und einem psychedelischen Space-Odyssey-Abenteuer entdeckte ich den yogischen Ansatz zur Spiritualität. Ich wollte weder Priester noch Kommunion. Ich wollte nicht auf den uninformierten psychedelischen Zirkusspielplatz. Der Nahe Osten verwies auf den Subkontinent, und die legendäre Geschichte Indiens und des Himalaya war absolut unwiderstehlich. Ich wollte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Besorgt mir einen Guru, und zwar schnell.
1972 (die Jahre kamen mir damals sooooooo lang vor) fand ich mich in einem schweren Mumienschlafsack aus Kriegsbeständen in einem Ashram wieder und starrte begeistert in den sternenübersäten Himmel am Fuße des Himalaya in Nordindien. In romantischer Stimmung stellte ich mir vor, endlich dort weiterzumachen, wo ich in meinem früheren Leben aufgehört hatte. Ich fühlte mich, als könnte ich fliegen … und ein Teil von mir dachte das auch. Schreiben Sie das meiner massiven Verwirrung darüber zu, was mich erwartete, jetzt, wo ich in die heilige Tradition der Yoga-Meditation eintrat. Ich war jung, naiv und bestens vorbereitet. Seien Sie nachsichtig mit mir. Man musste damals dabei sein, um es zu verstehen. Das war lange, lange vor dem Internet. Man musste ein Ferngespräch in einem nahegelegenen Hotel buchen, und ein Brief hin und zurück dauerte etwa drei Wochen. Am anderen Ende der Welt war man WIRKLICH weit weg von zu Hause.
Schließlich zog ich zurück nach Kanada und dann in die USA, wo ich jahrelang meditierte und reiste, um in anderen Ashrams zu helfen und bei Initiationssitzungen zu assistieren. Ich entwickelte Disziplin und erkundete die Hingabe, ohne zu merken, dass ich viel von meiner „Wir/Sie“-Irrsinnigkeit aus meiner frühen Zeit als Katholik in diesen neuen, exotischen Lebensstil mitnahm. Meine kindliche Überzeugung, dass „meine Religion in den Himmel kommt und deine in die Hölle“, verwandelte sich in die Einstellung „Mein Guru kann deinen Guru verprügeln“. Es gab so viel zu lernen, aber ehrlich gesagt auch so viel zu verlernen. Ich schätze, die Rettung in all dem war meine Entschlossenheit, ein reineres Bewusstsein zu entwickeln und zu verfeinern.
Es überraschte nicht, dass mit der Zeit, als ich mich vom „Katholischen“ abwandte, auch meine Bindung an den Guru schwand wie eine langsame, fast unsichtbare Trennung in einer Ehe, und ich eines Tages erkannte, dass es eine Scheidung war. Dann gab es keine Regeln oder mentalen Verpflichtungen mehr. Meine Sehnsucht nach dem „Heiligen“ hörte nie auf, und ich war wieder frei für „spirituelle Verabredungen“. Irgendwie gleichzeitig erleichtert und verloren. Das führte mich sehr vorsichtig zu einer koreanischen Form des Taoismus mit einem anderen Lehrer und einem ganz neuen Übungsstil. Lernen. Loslassen. Lernen. Loslassen. Lernen. Loslassen.
Nachdem ich zehn Jahre lang täglich zwei Stunden in einem bestimmten Meditationsstil verbracht hatte, war der Wechsel in koreanische Gesänge mit der dazugehörigen strukturierten Atmung eine echte Herausforderung für mich. Ich dachte mir, viele Wege führen nach Rom, und gewöhnte mich langsam an die Praxis. Die Herausforderung dabei (die bis heute anhält) besteht vor allem darin, das Ziel dieser oder jeder anderen spirituellen Praxis zu klären. Ich weiß, dass ein Teil meiner Psyche sich immer noch eine Art „göttlich-psychedelische“, glückselige Erlösung vorstellte … und dort im Nirvana zu bleiben, bis der Himmel mich wieder aufnahm … oder so etwas in der Art. Das erwartete „Ergebnis“ war eigentlich nie ganz klar. Es blieb eine Art „veränderter Bewusstseinszustand“ (ein Begriff von Charles Tart) oder ein „außergewöhnlicher Zustand“ oder vielleicht eine Art „psychedelischer Trip ohne Drogen“ oder ein plötzlicher Besuch im Himmel oder die Kosmische Wahrnehmung (um auf den kanadischen Psychiater Richard Maurice Bucke (1837–1902) zurückzugehen) oder sogar eine Art religiöse Erfahrung (William James). Man muss bedenken, dass der Großteil all dieser Versuche vor dem Internet stattfand und Informationen Buch für Buch und bei persönlichen Treffen zwischen Freunden und anderen „Suchenden“ weitergegeben wurden.
Weitere zehn Jahre vergingen, und nach vielen Monaten, darunter viele einsame Meditationsretreats in den Bergen, die ich monatelang in einem Zelt versteckte, stürzte mich ein psychisches Erdbeben in eine tiefe Sinnkrise und eine tiefe existentielle Erschöpfung. Das „Ziel“ war ein ferner Horizont, der sich scheinbar immer weiter entfernte, je näher ich kam. Und die Erkenntnis, dass meine „Bemühungen“ niemals in Erfüllung gehen würden. Auf einem Berghang sitzend, kam ich meinem „wahren Herzenswunsch“ so nahe wie nie zuvor. Es war das erste richtige Gebet meines Lebens … keine Worte … nur ein Hilferuf. Und so landete ich einige Monate später weinend im Schoß meines tibetischen Dzogchen-Lehrers.
Dzogchen ist eine der wenigen ausgereiften „nicht-dualen“ Traditionen, die es mit einer intakten Linie bis in unsere moderne Zeit geschafft hat. Einst eine sehr gehütete und geheimnisvolle Praxis, wurde Dzogchen durch die chinesische Invasion Tibets und die erzwungene Diaspora qualifizierter tibetischer Lamas in die Welt hinausgetragen. Ich hatte das große Glück, als „Privatschüler“ eines hoch angesehenen Dzogchen-Lehrers aufgenommen zu werden und in den letzten 30 Jahren den nicht-dualen Ansatz zu verinnerlichen. Dzogchen ist, wie andere nicht-duale Traditionen auch, eine heikle Angelegenheit und kann einen leicht mit einer supercoolen Philosophie verführen, die sich als das „Wahre“ ausgibt. Seine absolute Einfachheit klingt großartig, aber gerade die Herausforderung, die Einfachheit zu entwaffnen, macht es nicht einfach. Warum? Weil wir tief in unserer ununterbrochenen komplexen Intellektualisierung verwurzelt sind.
Im Laufe der Jahrzehnte hat die moderne Neurowissenschaft langsam Erkenntnisse über die Funktionen unseres physischen Gehirns gewonnen. Diese Erkenntnisse eröffnen Perspektiven, die es uns ermöglichen, körperliche Eigenschaften mit der „Black Box“ des Geistes in Einklang zu bringen. Können die Fortschritte der Neurowissenschaft zu einem besseren Verständnis unserer spirituellen Traditionen beitragen? Manche Menschen sind der Meinung, die Wissenschaft sei der „Feind“ der Spiritualität und „Gott ist tot“ und nur ein verständlicher, aber gescheiterter Aberglaube. Andere sehen das genaue Gegenteil und halten Wissenschaft und Spiritualität für einander ergänzend und „zwei Seiten derselben Medaille“. Ich gehöre zu denen, die beide Seiten derselben Medaille als einander ergänzend betrachten. Und diese Perspektive ist dem Kerndesign des NeuroVIZR-Erlebnisses inhärent. Mehr dazu beim nächsten Mal!
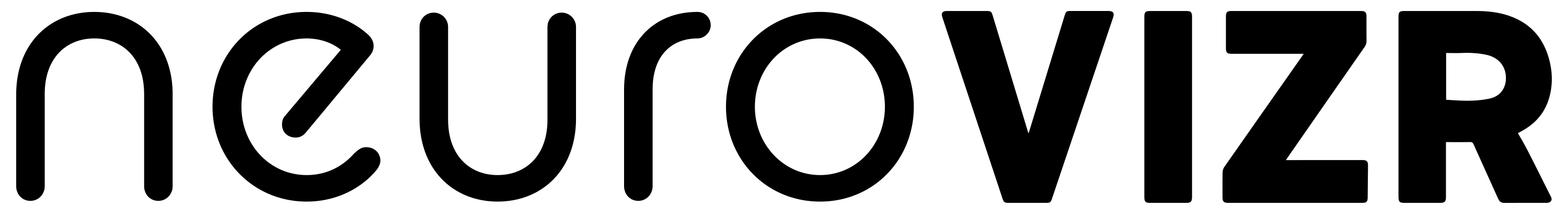


Worte des Gründers
Fahrstuhlfahren in meinem eigenen Kopf