Das Hauptmerkmal bestimmter Geräte ist das „photische Antreiben“ durch Stimulation mit „flackerndem Licht“.
Dieser Effekt fällt in die größere Kategorie der Neuromodulation. Bei einigen, aber nicht allen Geräten wird das „flackernde Licht“ mit verschiedenen pulsierenden Stimulationen auf Tonbasis kombiniert.
ÜBER IHR GEHIRN:
Unser Gehirn sucht immer nach dem „Signal im Rauschen“.
Es zieht es vor, fortlaufende sensorische Reize in Muster zu ordnen, um sie später leichter wiedererkennen zu können.
Mit einer Bibliothek von Mustern können Sie zukünftige Reaktionen einfacher und schneller vorhersagen. In gewisser Weise zieht unser Gehirn „immer voreilige Schlüsse“.
Hoffentlich sind diese Vorhersagen richtig.
Manchmal sind die Vorhersagen jedoch nicht genau … und unser Gehirn muss einige alte Muster durch neue, effektivere Muster ersetzen.
Nennen Sie es Veränderung, Anpassung, Lernen oder Wachstum. In jedem Fall ist es sehr wichtig, positive Muster (Gewohnheiten) aufzubauen, und es ist ebenso wichtig, in der Lage zu sein, zu besseren neuen Mustern zu wechseln, wenn eine Veränderung notwendig ist.
Technisch gesehen ist dieser „Tanz“ als „Stabilitäts-/Plastizitätsdynamik“ bekannt – und wir müssen in beiden Bereichen gut sein.
ARTEN VON FLACKERNDER LICHT- UND PULSIERENDER TONSTIMULATION:
Gehirn-Entrainment:
Dieses Phänomen wurde ursprünglich in den späten 1930er Jahren entdeckt und als Frequency Following Response (FFR) bezeichnet.
Da es an ausgereifter Technologie und Motivation mangelte, blieb die FFR bis in die 1960er und 1970er Jahre inaktiv. Damals wurde die FFR in Brain Entrainment umbenannt.
Brain Entrainment geht davon aus, dass das Gehirn bei Stimulation mit regelmäßigen und wiederholten Licht- oder Tonsignalen (und anderen Signalen wie Elektrizität und Magnetismus) beginnt, elektrische Gehirnwellen in der gleichen Frequenz zu produzieren.
Neurologisch gesehen ist Brain Entrainment in erster Linie ein Top-Down-Organisationsprozess, der auf Vorhersage und Mustererkennung basiert.
Untersuchungen haben gezeigt, dass der Prozess der Gehirnstimulation im Allgemeinen in zwei Phasen abläuft:
Überlagerung:
- In denen sich die stimulierenden Signale aufdrängen oder „aufzwingen“
auf das Gehirn; - Wenn das Signal während dieser Phase stoppt, reagiert das Gehirn normalerweise auch
stoppt die Generierung dieser Signale;
Mitnahme:
- In dieser zweiten Phase beginnt das Gehirn, die stimulierende Frequenz selbst zu erzeugen, und kann dies danach für eine unvorhersehbare (normalerweise kurze) Zeit fortsetzen.
- Um eine tatsächliche Synchronisation zu erreichen, sind typischerweise die regelmäßigen Wiederholungen
Das stimulierende Signal muss mindestens 6 bis 8 Minuten lang anhalten
im Stadium der „Überlagerung“.
Um das Gehirn erfolgreich auf eine bestimmte Frequenz zu synchronisieren, muss das Signal sein regelmäßiges und sich wiederholendes Muster beibehalten – Variationen, Unterbrechungen und Häufungen des Signals verringern den Überlagerungs- und Synchronisationsprozess schnell.
Es gibt verschiedene Arten von Entrainment-Signalen – jede hat ihre charakteristischen Merkmale:
Lichtsignale:
Isochrone Lichtsignale:
„Isochron“ bedeutet „gleiches (Iso-)Timing“ (chronisch);
Dieses regelmäßige Timing erzeugt den „Flimmereffekt“.
Jedes „Flackern“ kann eine andere „Form“ haben;
- Glatte Sinuswelle;
- Starres Quadrat;
- Scharfes Dreieck;
- Versetzter Sägezahn.
Jedes „Flimmern“ kann auch einen anderen „Arbeitszyklus“ haben;
- „Ein“ und „Aus“ können variieren;
- Beispielsweise kann der EIN-Wert 90 % der Energie betragen und der AUS-Wert 20 %.
Durch Variationen der Rate des isochronen „Flimmerns“ (z. B. 15 Hz), der Art der Signalform (z. B. Rechteckwelle) und des Tastverhältnisses (z. B. 80/20) kann die Qualität des Lichtsignals umfassend verändert werden.
Tonsignale:
Es gibt zwei Haupttypen von Tonsignalen für Brain Entrainment:
Isochron:
Wie oben erwähnt, ist das Tonsignal sehr regelmäßig;
Auch die Form kann variieren;
- Glatte Sinuswelle;
- Starres Quadrat;
- Dreieckig;
- Sägezahn;
- Andere werden ebenfalls weniger verwendet.
Das Tonsignal kann auch Variationen in der Tonhöhe oder im Ton aufweisen.
Auch die Lautstärke der Tonsignale kann variieren.
Binaural:
Binaurale Tonsignale werden anders erzeugt als isochrone Signale;
Isochrone Schallsignale werden „außerhalb des Kopfes“ erzeugt und über die Ohren gehört;
Binaurale Tonsignale werden auf besondere Weise „im Kopf“ erzeugt;
Um ein binaurales Signal „im Kopf“ zu erzeugen, kombinieren Sie zwei separate Töne – ein Ton (A) geht in ein Ohr und der andere Ton (B) geht in das andere Ohr;
Der Unterschied zwischen den Tönen A und B wird „im Kopf“ verarbeitet, um die
resultierender Ton (C).
Beispiel:
- Ton A ist 10 Hz;
- Ton B ist 15 Hz;
- Der resultierende Ton C wird als 5 Hz gehört
Wichtig ist, dass die „Spanne“ zwischen Ton A und Ton B begrenzt ist, um einen Ton C zu erzeugen;
Wenn die „Spreizung“ größer als 20 Hz ist, wird der resultierende Ton C schwächer – bei etwa 35 Hz verschwindet der Ton C praktisch – Ihr Gehirn kann den Unterschied zwischen den Tönen A und B nicht verarbeiten;
Bei der Erzeugung von Gehirnwellensignalen gibt es einen kleinen Frequenzbereich um 35 Hz, der als „Frequenzfusionsrate“ bezeichnet wird und bei dem die Flimmern zu einem einzigen zusammengeführten Signal zu „verschwimmen“ scheinen.
Folglich sind Behauptungen über ein binaural erzeugtes 40-Hz-Gammasignal nicht korrekt.
Isochrone vs. binaurale Tonsignale:
Binaurale Tonsignale wurden Anfang der 1970er Jahre identifiziert;
Die Brain-Entrainment-Effekte isochroner Signale sind viel effektiver als binaurale Signale.
Binaurale Tonsignale gelten als die schwächste Form der Tonsignalisierung zur Erreichung von Brain Entrainment.
Obwohl sie bei der Induktion von Brain Entrainment viel effektiver sind, sind isochrone Klänge nicht so beliebt, da sie ein höheres Maß an kompositorischer Gestaltung erfordern – andernfalls kann der isochrone Klang für den durchschnittlichen Benutzer unattraktiv und sogar irritierend sein;
Binaurale Tonsignale werden häufig verwendet, da sie sich sehr einfach in jede andere Tondatei einfügen lassen und einen unauffälligen Ton erzeugen, ohne dass konkurrierende oder störende Geräusche auftreten. Sie werden nicht verwendet, weil sie so effektiv sind, sondern weil sie unaufdringlich sind und es dem Hersteller dennoch ermöglichen, zu behaupten, dass ihre Tonquelle eine „Gehirnsynchronisation“ beinhaltet.
Weißes, rosa, braunes Rauschen:
Beim Brain Entrainment können verschiedene Formen von „Lärm“ eingesetzt werden, um die Ablenkung zu reduzieren.
Diese „zischenden“ Geräusche können den Zuhörer sehr effektiv in eine akustische „Hülle“ eintauchen lassen;
Solche Arten von „Geräuschen“ sind in Geräten mit „weißem Rauschen“ üblich, die störende Geräusche ausblenden, und sind in vielen Schlafmitteln enthalten.
Komponierte Musik:
Die Verwendung ansprechender komponierter Musik (in vielen verschiedenen Formen) kann zunächst verlockend erscheinen.
Der Nachteil besteht darin, dass unser Gehirn stark (sogar unwiderstehlich) von regelmäßigen und vorhersehbaren Mustern angezogen wird. Nicht integrierte Musik, die als Ton für Brain Entrainment verwendet wird, kann daher die „Frequency Following“-Reaktion auf die „Treiberfrequenz“ in der Signalisierung enorm verringern (dies gilt insbesondere, wenn die Musik parallel zu flackernden Lichtsignalen läuft). Dieser „Musterwettbewerb/-konflikt“ findet sich in vielen Soundtracks, die versuchen, subtile binaurale Tonsignale zu verwenden, die in rhythmische Musikkompositionen gemischt werden.
Zufällige Signalisierung:
Im Wesentlichen ist Random Signaling das Gegenteil von Brain Entrainment.
Beim Brain Entrainment bilden die Signale eine äußerst regelmäßige und vorhersehbare Stimulation, die das Kernmerkmal der Frequency Following Response darstellt.
Bei der Zufallssignalisierung sind die Signale höchst unregelmäßig und lassen sich nicht nach einem bestimmten Muster vorhersehen.
Neurologisch gesehen handelt es sich bei Random Signaling in erster Linie um eine „Bottom-up“-Infusion von Rauschstimulation, der es an jeglicher Nachrichtenauflösung oder Integrationsmöglichkeit mangelt.
Merkwürdigerweise behaupten einige Hersteller, die Random Signaling verwenden, dass es sich bei dem Prozess um einen Brain-Entrainment-Effekt handele, obwohl dies absolut nicht der Fall ist, da ihm alle Elemente der Frequency Following Response fehlen.
Zufällige Signale mit flackerndem Licht neigen dazu, die grundlegende Signalverarbeitung im Gehirn zu destabilisieren, was zu einem „dissoziativen“ subjektiven Geisteszustand führt.
Der dissoziative Zustand wird im Allgemeinen als ein seltsames „Schweben“ oder ein charakterloses Gefühl erlebt, das von Unerfahrenen fälschlicherweise für eine Form der Meditation gehalten werden kann.
In kleinen Dosen kann Random Signaling dazu beitragen, stressige oder starre Denkmuster abzubauen, obwohl die subjektive Reaktion für manche Menschen beunruhigend und unangenehm sein kann.
Wenn die Zufallssignalisierung zu oft und/oder über längere Zeiträume auftritt, können sich die anfänglichen dynamischen visuellen Darstellungen von Farben und geometrischen Mustern aufgrund einer schützenden neurologischen Hemmung im visuellen Kortex des Gehirns in strukturlose zweidimensionale Grautöne auflösen.
Das Gehirn sucht Schutz vor dem anhaltenden, stressigen „Lichtlärm“. Es wurde festgestellt, dass bei Personen, die an PTBS und/oder nervöser Erschöpfung leiden, eine ähnliche schützende visuelle Hemmung auftritt.
Gehirnaktivität:
Brain Engagement ist eine neue und fortschrittliche Form der Neuromodulation, die auf eine Art der Gehirnsignalisierung abzielt, die positive neuroplastische Veränderungen im Gehirn auslösen und steuern soll.
In der Ära des Brain Entrainment in den 1970er Jahren war man sich der normalen Fähigkeit des erwachsenen Gehirns, neue und positive neuroplastische Veränderungen zu entwickeln, nicht bewusst.
Vereinfacht gesagt verstärkt Brain Entrainment grundlegende Muster durch vorhersehbare Wiederholung und Brain Engagement stimuliert und leitet die Entstehung neuer adaptiver Muster im Gehirn.
Die Signalübertragung im Gehirn erfolgt „kompositorisch“, d. h., sie nutzt verschiedene Arten der Signalübertragung innerhalb der Licht- (und Ton-)Erfahrung.
Die Signale in der Komposition verschieben sich von aufmerksamkeitsstarker Destabilisierung zu wohlstrukturierten Botschaften, zu kurzen Konfliktphasen und zu verstärkenden Rückkehren zum Vektor oder Thema der Komposition.
Neurologisch gesehen handelt es sich bei Brain Engagement in erster Linie um eine strukturierte multisensorische „Bottom-up“-Stimulation mit sekundären Elementen periodischer integrativer „Top-down“-Nachrichtenübermittlung.
Um neuroplastische Veränderungen im Gehirn zu aktivieren, werden bei Brain Engagement Elemente der „Überraschung“ oder des „Vorhersagefehlers“ eingesetzt, um die selektiven Aufmerksamkeitszustände hervorzurufen, die für jede neuroplastische Methode erforderlich sind.
Der „Aufmerksamkeitszustand“, der für die Auslösung einer neuroplastischen Reaktion erforderlich ist, fehlt bei Brain-Entrainment-Methoden vollständig – die Frequency Following Response und die damit einhergehende, höchst vorhersehbare Signalwiederholung führen dazu, dass das Gehirn nicht „aufpassen“ muss und es daher keinen Auslöser für Veränderungen gibt.
Brain Engagement verwendet auch das Element der „Randanforderung“, das für jede wirksame neuroplastische Methode erforderlich ist – die Erfahrung muss nur ein kleines bisschen über Ihrem alltäglichen Komfortniveau liegen – diese „kleine Anforderung“ trägt dazu bei, die grundlegende Veränderungsdynamik auszulösen und positive neuroplastische Veränderungen im Gehirn herbeizuführen.
Brain Engagement verfügt außerdem über ein intrinsisches Thema (technisch gesehen einen „Vektor“), das die Nachrichtenübermittlung in Richtung eines bestimmten „Wahrscheinlichkeitszustands“ bewegt. Über das stark vereinfachte Konzept hinaus, dass eine einzelne Gehirnwellenfrequenz zu einem bestimmten subjektiven Geisteszustand führt, bietet der Vektor eine Art neurologische „Lektion“, die dabei hilft, den Prozess zuverlässiger in Richtung des projizierten „Wahrscheinlichkeitszustands“ zu bewegen. Durch Wiederholung wird das Sitzungsthema für den Benutzer natürlicher verfügbar.
Brain Engagement umfasst auch eine vollständig integrierte Audio-Klanglandschaft, die dynamisch mit dem Lichtkompositionserlebnis interagiert.
Die Klanglandschaft von Brain Engagement ist mit verschiedenen Arten der Gehirnwellensignalisierung überlagert, die in einen musikalischen Hintergrund zur „Stimmung“ eingewoben sind. Das Element der „Stimmung“ vermeidet absichtlich die vollständig strukturierten Merkmale herkömmlicher Musik und verhindert so die Tendenz des Gehirns, „das Schiff zu verlassen“ und seine Aufmerksamkeit auf die Musik zu lenken und den Themen-„Vektor“ aufzugeben, der dynamisch auf die neuroplastische Veränderung abzielt.
Sowohl Brain Enrichment als auch Brain Priming sind methodische Untergruppen von Brain Engagement. Wie Brain Engagement sind beide Ansätze explizit an dynamischen neuroplastischen Veränderungsfaktoren beteiligt.
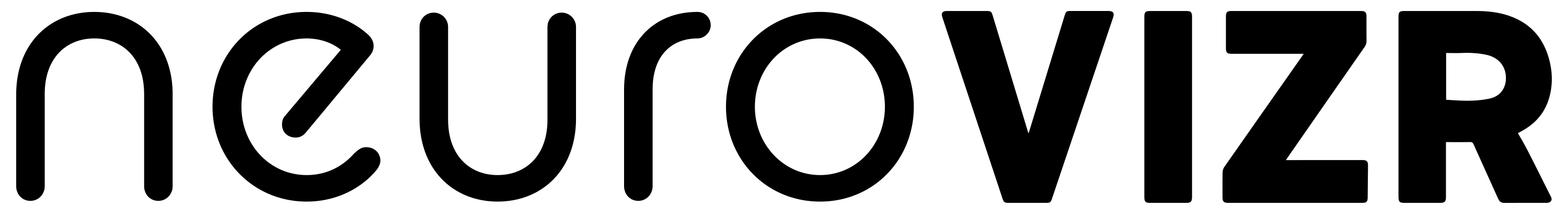


Wissenschaft und NeuroVIZR